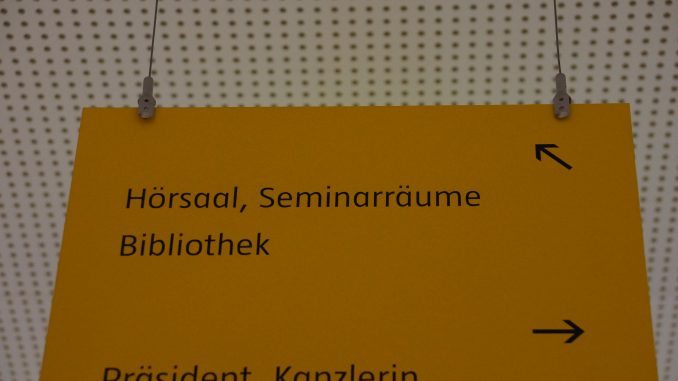
Das Streben des Szientismus nach Abgrenzung
Es hat neulich eine Sitzung in Heidelberg stattgefunden, wo besprochen wurde, worin das wissenschaftliche Phänomen spezifisch besteht. Sollte die Intuition des Wiener Kreises richtig sein, dann würde die Suche nach dem Spezifischen des wissenschaftlichen Phänomens einfach darin bestehen, diejenigen Phänomene auszunehmen, die da erscheinen, wenn der Wissenschaftler auf seine eigentümliche und edle Weise die Begebenheiten angeht. So einfach lässt sich aber die Sache nicht lösen.
Es könnte den Eindruck erwecken, dass das Interesse nach Abgrenzung der wissenschaftlichen Phänomene eigentlich nur danach trachtete, dieses neue Wissen, das sich nicht so sehr durch seinen Gegenstand wie vielmehr durch seine Praxis auszeichnet, von der antiken traditionellen Philosophie auszusondern. In der Tat sieht man hier des Öfteren eine gewisse Fortsetzung der empiristischen Kritik auf die Metaphysik. Diese Behauptung kann man aber nicht unreflektiert in Kauf nehmen, denn sie verschweigt nämlich, dass der von der aufkommenden Wissenschaft anzukämpfende Gegner eigentlich in ihren eigenen Reihen steht. Der eigentliche Gegner war in der Tat die eigene Praxis der Wissenschaftler, die nicht alle auf dieselbe Art und Weise vorgegangen sind. Der große Gegner dieser besonderen Vorgehensweise, die für die Wahrheit der wissenschaftlichen Phänomene gebürgt hat, und zwar als Ersatz für Gottes Rolle in Descartes’ rationalistischem Ansatz, war, dass es eigentlich nicht eine Vorgehensweise gab. Man sieht klar, warum in ihren Anfängen die Wissenschaftstheorie normativ war. Die Sache ist also wie folgt: das Bedürfnis nach Abgrenzung stammt von der Tatsache, dass nicht eine Vorgehensweise für alle Wissenschaftler gilt, sondern dass viele von ihnen unphilosophische Theorien gewagt haben, die ihrerseits Hypothesen und Unnachweisbares eingeführt haben. Solche Theorien, die sich im XVII. und XVIII. Jahrhundert vermehrt hatten, wie z. B. die Phlogistontheorie oder die Wellentheorie des Lichtesi, stellen den Anfang des Interesses nach Abgrenzung dar. Kein Metaphysiker denkt, dass solche Theorien metaphysisch sind, und weil sie auf Hypothesen zurückgreifen, werden sie auch nicht durch die neue Wissenschaft als wissenschaftlich betrachtet. Das würde sich also am Gebrauch von Hypothesen entscheiden. Unter dem Motto: „anders als bei den restlichen Wissensarten werden bei uns keine Hypothesen eingesetzt“, wurde ein scheinbar fruchtbarer Weg gebahnt, um die Absicht auf Abgrenzung zu gewährleisten. Man soll aber nicht übersehen, dass es sich dabei um eine Absicht, um einen Vorsatz handelte. Damit meine ich, es wäre viel einfacher gewesen, eine tatsächliche Trennung vorzufinden als sie lediglich zu beschreiben. Vielmehr bewegen wir uns in einem intuitiven Bereich. Nicht nur, dass eine durch eine Art vor-analytische Intuition aufgeklärte vorwiegende Mehrheit davon überzeugt war, dass die Phlogistontheorie nicht als wissenschaftlich angenommen werden sollte – so dass die heutigen Wissenschaftler kaum wissen, dass eine solche Theorie überhaupt je formuliert wurde, als würde die Sache sie nicht angehen-, sondern Laudan selbst ging so weit zu betrachten,ii dass solche „vor-analytische Intuitionen“ der Schlussstein seien, um die verschiedenen Wissensarten zu beurteilen. Nur wo solche vor-analytische Intuitionen unklar wären, sollten wir also auf ein ausgearbeitetes System von Normen zurückgreifen.iii Selbstverständlich musste dann Laudan selbst zugeben, dass es solche Intuitionen als einstimmige und währende Urteile gar nicht gibt.iv Wohlverstanden, es gibt solche Intuitionen schon, aber nicht als einstimmige und währende Urteile. Wo es versucht wurde, die aufgrund solcher vor-analytischen Intuitionen angesetzte Trennung theoretisch zu etablieren, entschied sich die Trennung am Gebrauch von Hypothesen.
Da alles, was mit Hypothesen zu tun hatte, als ein wenig zuverlässiges „Arbeitsinstrument“ betrachtet wurde, rügte Bacon Aristoteles (in dessen Philosophie andererseits sich nichts findet, was nicht durch den Syllogismus nachgewiesen worden ist), dass er weniger Wert an der Empirie (Phänomen) als an dem Grund des Phänomens legte. Für den Engländer hat die Beweisführung eine eher experimentelle als theoretische Bedeutung. Mit Plato gesagt, geht es dabei darum, die Beweisführung aus dem topos noetos (Welt der Bedeutungenv) hin in die Welt des Glaubens, der Meinung und der sinnlichen Bilder (doxa) hinzuführen. Aus Platos Gesichtspunkt war dies unangebracht, denn das Universelle nicht in der sinnlichen Welt weilt, und Recht dürfte er auch haben, denn wenig später kam Galileo, um Bacons Vorschlag zu entwerten. Galileo, so wie früher Plato, wird erneut sagen, die Phänomene müßten aus den zugrundeliegenden Gründen erklärt werden, allein sind bei ihm (näher zum mystischen Pytagorismus) solche Gründe nicht die Ideen an sich, sondern vielmehr mathematische Postulate. Auf jeden Fall wird er Platons Gesinnung teilen, das Universelle finde sich nicht im Sinnlichen.
Anders gesagt, es musste letztendlich zugegeben werden, dass Phänomene in der Tat gar nichts beweisen und nur zufällige Wahrheiten anbieten, womit die Relevanz des Phänomengrundes fürs Phänomen selber wiederhergestellt wurde. Bacons Anforderungen konnten nicht mehr entgegengekommen werden. Somit haben sich zwei Möglichkeiten eröffnet: entweder wird es festgestellt, dass nichts nachgewiesen werden kann, so dass nur eine empirische Feststellung bleibt (Ende der Erkenntnis nach Platos Mahnung), oder es wird endlich eine Methode festgesetzt, die für den Fortgang vom Sinnlichen zum Universellen bürgt und darüber hinaus jedes Wissen abgrenzt, das sich an diese Vorgehensweise anpasst. Das wissenschaftliche Phänomen würde sich insofern dadurch auszeichnen, dass es aufgrund des neu erfundenen Verfahrens erscheint. Bacon, Descartes, Locke, Hume und Kant haben zwar die Bedeutung der Methode herausgehoben, doch nur seit dem logischen Positivismus vereinigen sich das Bedeutungs- und das Verifizierbarkeitskriterium.
Newton schlägt den ersten Weg ein, den später Hume entwickeln und in der moralischen Welt umsetzen wird. Newtons Ansatz ersetzt das Ideal des Beweisens durch die empirische Bestätigung,vi doch er selber vermochte nicht, diesen Ansatz durchzuführen, so dass sein “schlechtes Verfahren” durch renommierte Philosophen vorgeworfen wurde: Philosophen setzen sich für die Methode ein, aufgrund deren sie später aus den wissenschaftlichen Fakultäten verbannt und in die liebe und weisevii Gegend der Geisteswissenschaften einengen werden. Noch heute wird es weitgehend übersehen, dass die verdächtige und dunkle Schwerkraft an diejenigen nicht zu beobachtende Wesen erinnert, von denen wir lediglich die Auswirkungen sehen. Tatsache ist, dass die Hypothese nach und nach angenommen wurde, bis sie auf eine korrekte Weise eingeführt wurde. So ist Whewells Meinung, dass sich die in den Phänomenen versteckten Wahrheiten nicht ohne die Erfindung von Hypothesen abgewinnen lassen. Somit kommt man auf Plato zurück: die Wahrheiten stecken nicht im Phänomen. Das ist der zweite Weg.
Die Hypothese soll wieder eingelassen werden. Whelwell lässt sie als „Arbeitsinstrument“ gelten, um die Tatsachen zu ordnen und sie einsehbar zu machen, indem man das Beobachtete mit der theoretischen Erklärung vergleicht und die Hypothesen miteinander auseinandersetzt. Da aber das Interesse nach Abgrenzung immer noch als zu stark gilt – was im Grunde genommen solch einem Interesse nach Unabhängigkeit ähnelt, wie das des Jugendlichen, der das Elternhaus verlassen will, was eher den Wissenschaftstheoretikern als der neuen Wissenschaft stammt, so dass das steigende Interesse am diesen Fragen Hand in Hand mit der Verselbstständigung der Wissenschaftstheorie als Einzeldisziplin geht-, so kommt man letztendlich auf die Gesinnung, es bestehe ein wesentlicher Unterschied, ob man mit Hypothesen umgeht oder ob man sie mit den Tatsachen auseinandersetzt.viii Durch diesen Kontakt mit den Tatsachen sollten die Hypothesen nachgewiesen werden, so dass sich die Ideen den Tatsachen unterwerfen sollten, was die Philosophie, Feindin der scheinbaren und oberflächlichen Empirie, nicht so gerne annehmen würde. War somit der Weg zur Lösung des Problems gefunden worden? Der Weg schien eingeebnet worden zu sein, man brauchte nur noch zwischen verifizierbaren und nicht-verifizierbaren Hypothesen zu unterscheiden.ix Aber das theoretische Problem, wie eine Hypothese zu verifizieren ist, hat mehr Schwierigkeiten als erwartet bereitet. Auf der einen Seite sind die Verifizierungstheorien auf folgendes Problem gestoßen: sollten nur diejenigen Hypothesen wahr sein, die inzwischen verifiziert worden sind, während die restlichen Hypothesen sinnlos sind – denn das Verifizierbarkeits- und das Sinneskriterium ohne weiteres gleichgesetzt wurden-, dann ist solch eine Hypothese wie: „auf der Gegenseite des Mondes sind Berge“, nicht wahr sondern sinnlos, solange man keine Mittel zur Hand hat, sie zu verifizieren (solche Hypothese war sinnlos und unsinnig im VII. Jahrhundert). Die Lösung war auch nicht zu sagen, wissenschaftlich sei jede Hypothese, die verifizierbar ist (und nicht nur die verifizierten), als würde es damit ausreichen, die Beobachtungen zu bestimmen, die über deren Wahrheit entscheiden könnten, obwohl wir die Mittel dazu nicht hätten. Diese Antwort ist nicht ausreichend, denn dazu kommt das Problem der Tragweite des Satzes, weil die universalen Sätze (und somit die Wissenschaftsgesetze oder solche Sätze wie: „jeder Mensch ist sterblich“) unmöglich zu verifizieren sind, so dass sie weder verifiziert noch verifizierbar sind. Dies hat dazu geführt, die Tragweite zu verringern: ein Satz hat Sinn, wenn es möglich ist, dass die Erfahrung sie wahrscheinlich macht.x Somit hat die Wahrscheinlichkeit endlich die Verifizierbarkeit ersetzt, um das Abgrenzungsproblem zu lösen. Wir sind da, wo wir am Anfang waren: es sollen ausschließlich diejenigen Theorien angenommen werden, die bereit sind, sich den Tatsachen unterzuordnen, auch wenn wir noch nicht im Klaren sind, wie solche Unterwerfung stattfinden soll. Vielleicht kann man dazu nur argumentieren, dass eine Hypothese dann wissenschaftlich ist, wenn sie die Tatsachen nicht verifizieren, sondern erst ungültig machen können. Somit geht aber der Elan danach zugrunde, mehr Wahrscheinlichkeit in den wissenschaftlichen als in den unwissenschaftlichen Hypothesen zu finden, denn sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ungültig (und nicht wahrer) gemacht werden können.xi
Doch damit hätten wir einen weiteren noch wichtigeren Punkt. Sollten die Tatsachen eine Hypothese ungültig machen können, und zwar nicht eine beliebige Tatsache, sondern das Erfahrungsfaktum, dann hat sich das Ganze überraschend umgedreht: die Vorgehensweise schöpft ihre Rechtsmäßigkeit daraus, was im Experiment erscheint, nämlich das Phänomen, während die Vorgehensweise, nämlich das feststellende Experiment, eingesetzt worden ist, eben um die Rechtsmäßigkeit des wissenschaftlichen Phänomens zu gewährleisten.
Um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, braucht man nur zu denken, dass die Praxis aufgrund deren das wissenschaftliche Phänomen erscheint, nicht nur die Unterwerfung unter die berechnende Methode ist (das Seiende ist nur, was der ratio unterworfen wird), sondern dass die wissenschaftliche Praxis darüber hinaus auf das Leben geht. Von diesem Leben sagt Feyerabend, je massiver das Wissenschaftsgebäude wird, desto dringender ist der Drang, aus ihm hinaus in die Freiheit zu flüchten.xii Feyerabends Anliegen war für die Wissenschaftstheoretiker irrationalistisch, und sein „anything goes“ wurde als die aufrührerische Tat eines abwegigen Relativisten gehalten, für den die Auswirkungen nichts zählen. Wäre es aber so gewesen, dann hätte Feyerabend seinen Ansatz nicht berichtigt, und zwar unter Berufung auf eben solche Auswirkungen, wie er es allerdings tat. Feyerabend ging es um die Verteidigung des Lebens, das bei den Diskussionen der Wissenschaftstheoretiker außer Acht gelassen wurde. Am Beispiel Galileo lautet Feyerabends Behauptung, dass aufgrund gut etablierter Theorien die Wissenschaftler nicht standhaltende Hypothesen ansetzen würden. Diese Vorgehensweise zu beseitigen bedeutet, die Lebenspraxis des Wissenschaftlers zu beseitigen, der als freies Wesen frei vorgehen kann. Dies ist zwar ein sehr bedürftiges Verständnis jener Lebenspraxis, aber die großartige Leistung Feyerabends und dessen unversöhnlicher Streit mit den Erben des logischen Positivismus gründet darin, dass Feyerabend das vom logischen Positivismus eingeschränkte Praxiskriterium bis in die Lebenspraxis des Wissenschaftlers erweitert hat, so dass der Glaube, die Wünschen und die Interessen des Wissenschaftlers mit einbeziehen werden und die Grenze zwischen Rechtfertigungs- und Entdeckungszusammenhang somit verwischt wird. Solches lebendige Anliegen zu übersehen bedeutet, sich einer intellektuellen und institutionellen Sklaverei zu unterwerfen, und zwar zugunsten einer Methode, die in der Lage sein will, die Ideologie zur wahren und nützlichen Theorie zu machen, was freilich für Feyerabend eine Schimäre ist.
Feyerabends Ansatz ist aber so lebendig, dass er nicht nur ins Leben vertieft, um die Lebenspraxis zu verstehen, sondern vielmehr beruft er sich leidenschaftlich darauf und hält somit einen epistemologischen Anarchismus, der, indem er die Existenz jeder eingeschränkten Methode kritisiert, letztendlich jedes Universellen verneint, womit Feyerabend zwar über den umgekehrten Weg aber ans selbe Ziel ankommt.
Leben als Offenheit
Die Bedeutung der angewandten Methode lässt sich freilich nicht streiten, davor kommt aber was Heidegger „das mögliche Anwesen der Anwesenheit“xiii nennt, nämlich das Phänomen, das sich dem Verständnis öffnet, indem es in ein Netz von Bedeutungen eingebettet ist, aus dem es seinen Sinn schöpft – die Offenheit, die zwischen Sein (nicht Phänomen) und Denken waltet und beide in deren Zusammengehörigkeit vereint. Anders ausgedrückt, es kommt eine ursprünglichere Vermittlung wie die der Methode vor, in der die Szientisten das Spezifische des wissenschaftlichen Phänomens gesucht hatten, nämlich das Welten der Welt. In der Regel lachen Szientisten über diesen Ausdruck Heideggers als sinnlos. „Die Welt weltet“: da dieser Satz über die Möglichkeit der Anwesenheit redet, bleibt diese im Dunkel und somit eine weitere abstrakte Idee der traditionellen Philosophen. Mit der Geduld für die theoretische Betrachtung, die der philosophischen Tätigkeit eignet, hätten sie aber bemerkt, dass es dabei um etwas Grundlegendes für deren eigenes Abgrenzungsinteresse geht, und zwar, dass sich vor der Anwendung der wissenschaftlichen Methode das Phänomen aufgrund dessen Zugehörigkeit zur umgebenden Welt uns mit einem Sinne geöffnet hat.
Die Kognitivisten wissen zu gut, dass das, was erscheint, Ergebnis eines Vorgangs ist, wo die Information manipuliert wird. Darüber hinaus ist es aber auch Ergebnis einer kausalen Wechselwirkung von Wirklichkeit und dialektischer Vermittlung der Überlieferung, wie Gadamer jene – mit Heidegger gesprochen – umgebende Welt nennt. In Wahrheit und Methode erörtert Gadamer Platos Dialektik und zeigt jene Logik von Frage und Antwort, die das Wissen zu einer Dialektik macht, nämlich die Kunstfertigkeit, an einem Gespräch teilzunehmen, wo die Sprechenden sich vertiefen und sich Universalkonzepte bilden.
Plato hat übersehen, dass es dabei eine ursprünglichere Vermittlung gab, nämlich die der Lebenswelt. Somit hat er auch übersehen, dass der unmittelbare Gegenstand in einen Horizont eingebettet ist, das ihm vorhergeht. Es war Husserls großer Beitrag, der die heutige philosophische Debatte eingeprägt hat, darauf hinzuweisen, dass solange die Wissenschaftstheorie weiter glaubt, dass das, was gemessen wird, die Außenwelt ist, dann stellt der Auftritt der Lebenswelt eine höchstinteressante Frage: was ist, wenn das, was gemessen wird, nicht die Außenwelt sondern vielmehr die erlebte Welt ist? Der Thermometer misst als objektive Temperatur die erlebte Hitze und Kälte. Die Vergessenheit dessen ist die Vergessenheit der Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnis (die Krise der europäischen Wissenschaften). Wenn es aber so ist, dann muss man zugeben, dass das, was der Wissenschaftler misst, bereits im Vorfeld vermittelt worden ist. Beharren wir darauf, diese ursprünglichere Vermittlung zu übersehen, dann laufen wir in Gefahr, das Leben zu übersehen, und somit uns in einen Lebensstil einzuengen: die bloßen Tatsachenwissenschaften schaffen bloßen Tatsachenmenschen: dies war Feyerabends große Sorge. Phänomenologie gilt als Reaktion gegen den im XIX. Jahrhundert vorherrschenden Szientismus und Positivismus, eine Reaktion, die danach trachtete, dem Leben seine Bedeutung zurückzugeben, indem es zum philosophischen Thema schlechthin macht. So wird Heidegger behaupten, Philosophie ist ursprünglicher, weil sie das Ursprungliche denkt.
Nicht die wissenschaftliche Methode macht ein Phänomen wissenschaftlich und ein Wissen zur Wissenschaft, sondern erst die Anwesenheit des Phänomens innerhalb einer Lebenspraxis, die den wissenschaftlichen Sinn des Phänomens vorwegnimmt. Diese Gesinnung wird keinen Platz in den heutigen Diskussionen der Wissenschaftstheorie finden, solange man nicht bereit ist, den Satz „die Welt weltet“ zu verstehen. Anders gesagt, die „external History” nicht ist so sekundär, wie Lakatos meint.xiv Indem Laudan die Existenz von Forschungstraditionen betrachtet, die Lakatos’ Forschungsprogramme ersetzen, hat er möglicherweise die Linie gezeichnet, die das Problem aufhebt, und hat somit die Tür fürs Wiedertreffen von Philosophie (Phänomenologie) und Wissenschaftstheorie geöffnet. Gegen Lakatos hat Laudan Recht, insofern die Forschungstraditionen die Aufgabe erfüllen, darauf hinzuweisen, welche Voraussetzungen diskussionsfrei sind, welche Momente einer Theorie geändert werden müssen, welche Regeln festzusetzen sind und welche Begriffsprobleme eine Theorie bereitet. D. h. sie bestimmt eine allgemeine Ontologie und eine generelle Methode, die Probleme innerhalb eines bestimmten Bereiches zu lösen.xv Laudans Hinweis zu folgen, das könnte die Wissenschaftstheorie zur phänomenologischen Entdeckung jener ursprünglichen Vermittlung führen, die uns offenbart, dass jede Methode erst darauf Anwendung findet, was bereits vermittelt wurde. Es werden die Grundlagen für die Verteidigung der oben genannten vor-analytischen Intuitionen festgesetzt, die ihre Rolle beim Abgrenzungsinteresse des Szientismus spielen. Solange nicht darauf geachtet wird, wird das Problem des Spezifischen vom wissenschaftlichen Wissen und Phänomen, sowie das des Spezifischen von jeder Art Wissen und Phänomene, ungelöst bleiben.
Kontakt und weitere Informationen zum Autor erhalten sie unter Universidad de Málaga, Homepage: www.uma.es.
i Cfr., Laudan, 1981.
ii Laudan, 1977, p 160.
iii Laudan, 1977, p 162-3.
iv Cfr., Laudan, 1986.
v Cfr., Emilio Lledó, 1984.
vi Newton, libro III, cuestión 31.
vii Wo die Weisheit nicht mit Methoden, sondern vielmehr mit Erkenntnisgegenständen zu tun hat.
viii Cfr., Whewel, 1847, p 55.
ix Cfr., Mill, 1973, pp 437, 438, 494 y 496.
x Cfr., Ayer, 1936.
xi Cfr., Popper, 1934.
xii Cfr., Feyerabend, 1975.
xiii Heidegger, Zur Sache des Denkens, 1969 , spanische Übersetzung 1975.
xiv Cfr., Lakatos, 1974.
xv „Una tradición de investigación especifica una ontología general y un método general de resolver los problemas dentro de un dominio determinado“; Laudan, 1977, pp. 84.







Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.