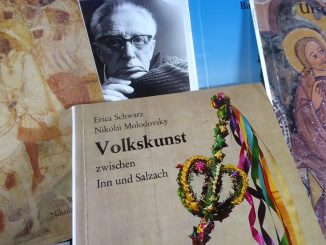Selbst der größte Zweifler unter Gottes großer Sonne, der Vater der „Gott-ist-tot“-Theologie, Friedrich Nietzsche, musste bekennen, dass ohne Musik alles Irrtum ist. Mit Johann Strauss Sohn trat der Walzer endgültig in die Seelen der Menschen – und seitdem tanzt die Welt im Dreivierteltakt.
Ob als Friedensbotschaft beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker oder beim legendär pompösen Wiener Opernball – die Menschheit, ob von den Schatten des Krieges, der Armut oder persönlicher Schicksale gezeichnet, vermag bei Strauss’ Klängen und im Rausch des Tanzes im Augenblick zu verweilen und aus der Tristesse des Daseins Mut, Freude und Hoffnung zu schöpfen. Geflügelt ist längst das Kommando „Alles Walzer! Schön, prickelnd, betörend“, mit dem der weltberühmte Opernball in der Wiener Staatsoper alljährlich eröffnet wird und das Prominente wie Glitzersterne in einen kollektiven Taumel fallen lässt. Im Prachtbau an der Ringstraße, begonnen 1861 und 1869 vollendet nach Plänen der Architekten August Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll, eröffnet der Eröffnungswalzer „An der schönen blauen Donau“ seit Jahrzehnten als stille Nationalhymne Österreichs die Herzen Tausender.
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“
Manchmal, an stillen Tagen, scheint es, als könne Musik mehr erinnern als jedes Buch und jeder Spaziergang, mehr als manche zärtliche Leidenschaft, mehr als das Leben selbst in seinen glücklichen Momenten zu schenken vermag. Bereits die Mystikerin, Äbtissin, Naturwissenschaftlerin und Heilige Hildegard von Bingen (1098–1179) schrieb: „In der Musik hat Gott den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen.“ Und Nietzsche, der sonst mit dem Göttlichen haderte, bekannte in der „Götzen-Dämmerung“: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“
Diesen Glücksrausch des Vollkommenen in einer unvollkommenen Welt, diese Kraft der Hoffnung inmitten der Mühen des Alltags, die sich wie ein Bohrer ins tote Holz der Wiederholungen frisst, in Klang zu bannen – darin war Johann Strauss Sohn ein Meister.
Welt von gestern – Musik für morgen
Geboren 1825 an der „schönen blauen Donau“, als das Habsburgerreich, ursprünglich ein Schweizer Herrschergeschlecht, noch in voller Blüte stand, bevor Industrialisierung, Nationalismus und soziale Spannungen den Vielvölkerstaat zermürbten und 1918 im Ersten Weltkrieg versanken, blieb der Komponist Strauss ein klingendes Relikt dieser „Welt von gestern“, die Stefan Zweig in seinem Jahrhundertwerk beschrieb. Ein Superstar seiner Zeit, dessen Walzer die Welt im lichten Glanz durchweben – und dessen Musik bis heute wie Trost und Hoffnung wirkt.
Ein leidenschaftlicher Musiker
Strauss war ein leidenschaftlicher Musiker, ganz durchdrungen vom Geist der Töne, die beflügeln, und zugleich ein Meister der Selbstinszenierung. Hätte es damals Marketing gegeben, er wäre sein genialster Vertreter gewesen. Mit seinen vielen Ehen war er kein Moralist und Biedermann, vielmehr ein Anbeter der Schönheit, ein Lebensfanatiker par excellence. Inmitten von Nationalismus und Aufrüstung, in Zeiten zersplitternder Weltreiche, schuf er etwas, das nicht trennte, sondern verband. Seine Musik vereinte, wo die Politik spaltete.
Der Walzer, wie Strauss ihn komponierte, war Haltung und Weltanschauung, eingeschrieben in den Dreivierteltakt. Was in „An der schönen blauen Donau“ schwebt und kreist wie Wasser um einen Stein, ist kein bloßer Eskapismus. Es ist Widerstand gegen die brutale Linearität, mit der Geschichte über Europa hinwegrollte. Während Preußen marschierte, während Salons vom Ruhm der Kanonen sprachen, ließ Strauss die Menschen tanzen – dicht aneinandergedrückt, drehend, nicht kämpfend. Er schuf eine Welt der Takte, die nicht marschierten, Klänge, die nicht befahlen, sondern einluden. Vielleicht war es gerade diese Leichtigkeit, diese scheinbare Unschuld, die so unerhört war – und die bis heute nachhallt.
Jacques Offenbach als Quelle der Inspiration
Als Johann Strauss im Jahre 1864 in Wien Jacques Offenbach begegnete, war es mehr als eine höfliche Visite zweier Größen der Musik, es war ein geistiger Funke, der übersprang. Offenbach, der Vater der modernen Operette, zeigte Strauss, wie das Genre zwischen Ironie und Leichtigkeit, zwischen Witz und Tiefsinn schillern konnte. Aus diesem Augenblick erwuchs in Strauss der Entschluss, nicht allein der „Walzerkönig“ zu bleiben, sondern die Bühne zu erobern und sich in jenem Terrain zu messen, das die Pariser Öffentlichkeit bereits triumphal gefeiert hatte.
Sieben Jahre nach dieser Begegnung, am 10. Februar 1871, kam es im Theater an der Wien zur Uraufführung seiner ersten Operette „Indigo und die 40 Räuber“. Was anfangs wie ein Wagnis schien, wurde zu einem programmatischen Neubeginn, denn Strauss stellte sich damit bewusst in Konkurrenz zum französischen Meister. Doch zugleich verlieh er der Operette eine eigene Handschrift, die in ihrer Verbindung von Walzerklang und dramatischer Form unverkennbar blieb.
Dass Strauss seine Werke nicht selten als „komische Oper“ bezeichnete, verweist unmittelbar auf Offenbachs Einfluss. Aber zugleich steckt darin ein Bekenntnis: Die Operette war für ihn kein leichtes Unterhaltungsspiel, sondern eine Kunstform, in der sich der Ernst des Lebens durch das Lächeln der Musik offenbarte.
In der Operette fand Strauss den Raum, über die Grenzen des Tanzes hinauszugehen, ohne seine Herkunft zu verleugnen. Hier verband er das Leichte mit dem Schweren, das Komische mit dem Tragischen, den Walzer mit der Szene. So wurde aus der Begegnung mit Offenbach ein Wendepunkt, der das Werk des Wiener Meisters nicht nur erweiterte, sondern ihm eine neue Dimension von künstlerischer Freiheit schenkte.
Symbolik des Taktes
Der tiefere Sinn des Walzers liegt in der Symbolik des Taktes: Zwei Menschen bewegen sich aufeinander zu, drehen sich umeinander, ohne einander zu verletzen. Kein Sieger, kein Besiegter. Nur Rhythmus, Balance, Gleichgewicht. In einer Welt, die nach Dominanz verlangt, ist das revolutionär. Strauss erklärte es nie – er ließ es hören.
Strauss war kein naiver Romantiker. In seiner Musik schwingt Melancholie, Wehmut, das Wissen um Vergänglichkeit. Die Euphorie seiner Rhythmen kennt das Ende; sie tanzt nicht blind, sondern wissend. Darin liegt die Größe seiner Kunst: das Leben feiern, ohne den Tod zu leugnen; Hoffnung klingen lassen, nicht Illusion. Der gebürtige Wiener war ein Diplomat der Töne. Wer im Dreivierteltakt tanzt, spricht ohne Worte. Wer denselben Walzer hört, erfährt Zugehörigkeit, etwas, das kein Staatsvertrag stiften kann. Während die Friedensaktivistin Bertha von Suttner mit der Feder gegen den Wahnsinn der Kanonen kämpfte, komponierte Strauss Lieder, in denen die Welt sich rund drehte, in denen die Schwerkraft des Lebens für einen Moment aufgehoben war. Beide wussten: Frieden beginnt nicht auf dem Schlachtfeld, er beginnt im Innersten des Menschen.
Der Walzer als Widerrede zur Gegenwart
Dass Strauss heute wiederkehrt – nicht nur in Konzertsälen, sondern im Denken der Menschen –, ist kein Zufall. In einem Jahrhundert, zerbrechlich wie Glas, voller Krisen – Klima, Krieg, künstliche Intelligenz – ist es der Walzer, der uns aufhält. Nicht als Nostalgie, sondern als Erinnerung an ein anderes Miteinander. Eines, das nicht auf Abgrenzung, sondern auf Annäherung gründet. Ein Miteinander, das kreist, statt zu kollidieren.
Zwei Jahrhunderte nach seiner Geburt ist Strauss aktueller denn je. Nicht weil wir seine Melodien wiedererkennen – sie hatten stets Konjunktur –, sondern weil wir seine Botschaft neu hören. Sie ist zart, fast flüchtig. Doch wer still genug ist, vernimmt sie durch das Getöse der Gegenwart: Das Leben bleibt – trotz allem – tanzbar. Der Mensch ist nicht zum Marsch, sondern zum Walzer geboren. Und das ist vielleicht in einer Welt der Disruptionen der schönste Gedanke, den wir uns schenken können.