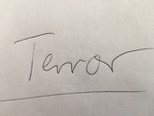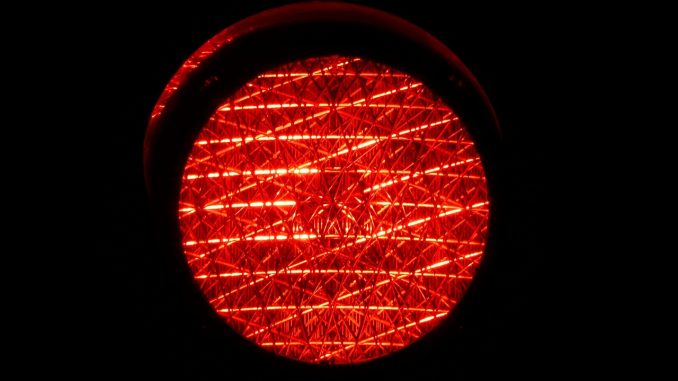
Die Verkehrspolitik der Landeshauptstadt München beansprucht Klimavorbildlichkeit, produziert jedoch durch ihre Ampeltaktung das Gegenteil: erzwungenen Stillstand, höheren Kraftstoffverbrauch und steigende CO₂-Emissionen. Autos verbrauchen selbst im Leerlauf bis zu 1,5 Liter pro Stunde und erzeugen dabei – ohne einen einzigen Meter zurückzulegen – rund 2,3 Kilogramm CO₂ pro Liter. Jede künstlich herbeigeführte Unterbrechung führt zu zusätzlichem Anfahren, der verbrauchintensivsten Phase des Motorbetriebs, und erhöht damit die Emissionen messbar. Während die Deutsche Umwelthilfe gegen Grenzwertüberschreitungen prozessiert, bleibt sie zu dieser strukturell verursachten Emissionssteigerung bemerkenswert still. Eine Anmerkung von Stefan Groß-Lobkowicz.
Sobald man in der Landeshauptstadt München eine grüne Ampel überfährt, beginnt eine eigentümliche Choreographie, die für den kundigen Beobachter schnell zum Muster wird: Die nächsten hundert Meter bleiben keine offene Strecke, sondern verwandeln sich fast zuverlässig in die nächste Rotphase. Es wirkt, als hätte die Stadt eine fein abgestimmte Dramaturgie des Innehaltens entworfen, als sollten die Wege nicht verkürzt, sondern rhythmisiert werden – nicht zugunsten der Mobilität, sondern zugunsten eines politischen Programms, das sich weniger an der Realität des Verkehrs orientiert als an einer Idee seiner Umerziehung. Der fließende Verkehr ist in München nicht selbstverständlich, sondern ein Ausnahmezustand, der nur kurz gewährt wird, bevor eine erneute Unterbrechung einsetzt. So entsteht ein Bewegungsparadox: Die Straßen existieren, die Fahrzeuge rollen an, doch das Fortkommen erscheint wie eine Geste, nicht wie ein Ziel.
Dieser Zwang zum Stillstand hat eine klar messbare Konsequenz. Ein Auto, das immer wieder zum Stehen gebracht wird, verbraucht im Leerlauf zwischen 0,6 und 1,5 Litern pro Stunde, ein Verbrauch, der vollkommen unabhängig davon entsteht, ob das Fahrzeug tatsächlich bewegt wird. Es ist ein Energieverlust im buchstäblichen Sinn – ein Motor, der sich verausgabt, ohne Fortschritt zu erzeugen; eine Art mechanischer Sisiphos-Arbeit, deren Absurdität im Alltag kaum noch bemerkt wird, gerade weil sie so selbstverständlich geworden ist.
Der Widerspruch zwischen Leitbild und Wirklichkeit
Während die rot-grüne Stadtregierung mit großer Geste von Klimaschutz, Transformation und einer Mobilitätswende spricht, die Münchens Zukunft sichern soll, zeigt die Stadt im Alltag ein entgegengesetztes Gesicht. Die technische Realität erlaubt sich keine moralischen Zwischentöne. Ein Verbrennungsmotor folgt nicht politischen Leitbildern, sondern physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Jeder erzwungene Stopp erhöht den Verbrauch, weil der Motor unter Last erneut beschleunigen muss; jedes Wiederanfahren verursacht kleine, aber kumulative Lastspitzen, die in Summe zu realen Mehrverbräuchen führen; und jedes Intervall des Leerlaufs erzeugt Emissionen, die sich exakt benennen lassen, aber in keiner umweltpolitischen Präsentation auftauchen.
Wer täglich an zehn Ampeln steht – und das ist in München keine theoretische, sondern eine alltägliche Erfahrung –, verbraucht allein durch das Warten 0,1 bis 0,25 Liter Kraftstoff. Eine Menge, die sich nahezu unsichtbar in den Tag einschreibt, aber im Jahresmaßstab mehrere zusätzliche Tankfüllungen ergibt, die nicht aufgrund der Strecke, sondern aufgrund politisch gesetzter Stopps entstehen. Dazu kommt der Emissionsfaktor selbst: Ein Liter Benzin setzt rund 2,3 bis 2,37 Kilogramm CO₂ frei. Der Stillstand produziert also Emissionen, die – bezogen auf die zurückgelegte Strecke – nicht nur ineffizient, sondern theoretisch unendlich sind, da kein Kilometer entsteht, aber CO₂ freigesetzt wird. So kollidiert der ökologische Anspruch der Stadt mit der elementaren Logik des Verbrennungsvorgangs. Man kann Emissionen rhetorisch wegdefinieren, aber nicht technisch.
Die Konsequenzen einer Verkehrsdidaktik
München hat im Laufe der Jahre eine Verkehrsdramaturgie entwickelt, in der Stop-and-Go nicht als Störung verstanden wird, sondern als regulierte Form der Fortbewegung. Es ist geradezu paradox: Ausgerechnet in einer Zeit, in der Mobilität effizienter werden soll, schafft die Stadt Strukturen, die Ineffizienz erzwingen.
Dabei ist seit Jahrzehnten bekannt, dass die verbrauchsstärkste Phase des Motorbetriebs nicht die gleichmäßige Fahrt ist, sondern das Anfahren, bei dem das Fahrzeug die kurzfristig höchste Energiemenge abrufen muss. Ein Auto, das konstant rollt, erreicht Verbrauchswerte von 3 bis 5 Litern pro 100 Kilometer – Zahlen, die sich unter optimalen Bedingungen sogar weiter senken ließen. Doch ein Auto, das immer wieder abgebremst und neu beschleunigt werden muss, verbraucht unvermeidlich mehr. Es ist die Summe vieler kleiner Unterbrechungen, die den Verbrauch in die Höhe treibt und die CO₂-Bilanz verschlechtert, ohne dass sich die gefahrene Strecke oder der Nutzen verändert.
Die Ironie liegt darin, dass moderne Fahrzeuge mit Start-Stopp-Systemen genau entwickelt wurden, um jene Emissionen abzufangen, die im Leerlauf entstehen – während München durch seine Ampelschaltungen Bedingungen schafft, in denen Start-Stopp zwar ständig aktiviert werden muss, aber der Effekt durch die Häufung der Stopps nahezu neutralisiert wird. Eine Stadt, die sich der ökologischen Zukunft verpflichtet sieht, verwechselt dabei politische Symbolik mit technischer Vernunft.
Die Deutsche Umwelthilfe – ein blinder Fleck im eigenen Raster
Bemerkenswert ist, wie still die Deutsche Umwelthilfe an diesem Punkt bleibt. Eine Organisation, die sonst keine Hemmung hat, Städte zu verklagen, Fahrverbote zu fordern oder Grenzwerte mit akribischer Genauigkeit einzufordern, vermeidet hier die direkte Auseinandersetzung.
Der Grund ist nicht schwer zu erkennen: Die systemischen Emissionen des städtischen Stop-and-Go lassen sich nicht einzelnen Autofahrern anlasten. Sie sind nicht das Ergebnis individueller Entscheidung, sondern politischer Infrastruktur. Sie entstehen nicht durch das „falsche“ Verhalten der Bürger, sondern durch die Entscheidungen der Stadt. Eine Kritik daran würde das eigene Deutungsmodell irritieren, das gern mit moralischer Eindeutigkeit operiert – und genau deshalb an dieser Stelle verstummt.
Doch der Effekt bleibt derselbe: Hochgerechnet auf eine Großstadt führte diese steuerungsbedingte Form des Stadtverkehrs zu hunderttausenden Litern unnötig verbrannten Kraftstoffs pro Jahr. Eine Zahl, die kaum wahrgenommen wird, weil sie sich nicht in einer einzelnen Messung manifestiert, sondern im schleichenden, alltäglichen Stillstand.
Das Paradox der klimapolitisch gewollten Ineffizienz
So ergibt sich ein Bild, das nicht konstruiert wirken muss, weil es sich Tag für Tag im Stadtverkehr bestätigt: Eine Politik, die Emissionen reduzieren möchte, schafft Bedingungen, unter denen Emissionen zuverlässig steigen. Eine Stadt, die Nachhaltigkeit propagiert, erzeugt durch unterbrochene Mobilität eine Form ökologischer Ineffizienz, die nicht zufällig, sondern strukturell ist. Und eine Umweltorganisation, die sich moralisch positioniert, bleibt ausgerechnet dann still, wenn Emissionen nicht aus individueller Nachlässigkeit, sondern aus politischer Steuerung entstehen.
München wird damit zu einem Beispiel jener Diskrepanz, die entsteht, wenn politischer Anspruch und technische Wirklichkeit auseinanderfallen. Die Ideologie der Verkehrswende übersieht die Physik des Motors – und die Physik, unbestechlich wie sie ist, korrigiert den politischen Anspruch auf ihre eigene, nüchterne Weise.
Die Münchner Verkehrspolitik gleicht einer These, die durch ihre alltägliche Praxis widerlegt wird. Die Fakten sind eindeutig, und sie sind unbestechlich:
Leerlauf kostet Sprit. Beschleunigung erhöht den Verbrauch. Jede unnötige Rotphase produziert Emissionen. Jede kaskadierende Ampelschaltung vervielfacht sie. Und so geschieht das eigentlich Unaussprechliche: Die rot getaktete Landeshauptstadt erzeugt ihre Emissionen nicht trotz, sondern gerade durch ihre Verkehrspolitik. Eine Einsicht, die weniger polemisch ist, als sie klingt – und der politischen Rhetorik deshalb so schwerfällt, weil sie schlicht wahr ist.