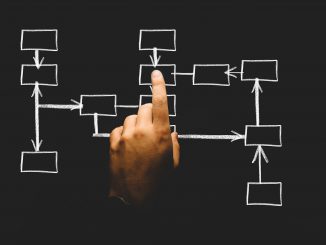Ende November 2018 ging ein Aufschrei um die Welt, als bekannt wurde, dass das Team des chinesischen Genforschers He Jiankui an der Universität Shenzhen erfolgreich in die Keimzellen der Zwillings-Mädchen Lulu und Nana eingegriffen hat, um eine Anlage für HIV/AIDS auszuschalten. Zwar gibt es schon seit Beginn der 1990er Jahre mehr oder weniger erfolgreiche Versuche einer gezielten Reparatur krankhaft veränderter Gene. Doch immer handelte es sich dabei um Eingriffe in Körperzellen. Eingriffe in die Keimzellen gelten bis heute als Tabu, weil nach dem heutigen Stand des Wissens niemand ausschließen kann, dass sich dadurch auch unerwünschte genetische Veränderungen unkontrolliert und nicht rückrufbar in der Nachkommenschaft ausbreiten könnten. Deshalb verurteilte auch die große Mehrheit der chinesischen Genforscher He Jiankuis Schritt. Dieser bediente sich bei seinem Eingriff einer neuen, erst seit 2012 bekannten Technik mit dem zungenbrecherischen Namen CRISPR/Cas9, die von der französischen Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und der amerikanischen Biochemikerin Jennifer Doudna entwickelt wurde.
Emmanuelle Charpentier, jetzt Direktorin des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin, konnte zeigen, dass man mit der nach dem Vorbild bakterieller Virenabwehr entwickelten „Gen-Schere“ CRISPR/Cas9 auch bei höheren Pflanzen und Tieren (einschließlich der Menschen) mit vergleichsweise geringem Aufwand unerwünschte Gene mit hoher Präzision eliminieren und eventuell durch nützlichere ersetzen kann. Daher die Versuchung, diese Technik nicht nur in der Pflanzenzüchtung sowie in der Tier- und Humanmedizin, sondern auch für die Züchtung von Wunschkindern einzusetzen.
Dagegen gibt es nicht nur ethische Bedenken. Vielmehr mahnen auch bisherige zwiespältige Erfahrungen mit Versuchen der Gentherapie zu großer Vorsicht. Ein Ende Juni 2016 veröffentlichtes Editorial im Wissenschaftsmagazin „Nature“ warnt davor, die „Gen-Schere“ CRISPR/Cas9 vorschnell am Menschen für die Bekämpfung von Krebs und anderen Leiden einzusetzen. Denn Fehlschläge könnten die Gentherapie um viele Jahre zurückwerfen. Das Editorial verweist dabei auf das schreckliche Schicksal des 18-jährigen Patienten Jesse Gelsinger im Jahre 1999. Gelsinger litt an der angeborenen Krankheit OTC (Ornithin Transcarbamylase Defizit). Ihm fehlte also das Enzym, das normalerweise verhindert, dass die Blut-Konzentration vom Ammoniak, eines Abfallprodukts des Protein-Stoffwechsels, auf toxische Werte ansteigt. Aus Experimenten mit Mäusen wusste man, dass OTC im Prinzip relativ einfach behoben werden kann, indem man das Gen für das fehlende Enzym in den Organismus einschleust.
Als Gelsinger in das Gentherapie-Experiment einwilligte, hatte sich sein Gesundheitszustand infolge einer geeigneten Diät in Verbindung mit Medikamenten schon einigermaßen stabilisiert. Als ihm dann ein Ärzte-Team unter Leitung von James M. Wilson an der Universität von Pennsylvania das fehlende Gen mithilfe eines abgeschwächten Adenovirus einschleuste, reagierte Gelsinger aber mit einem Multiorganversagen und starb nach drei Tagen. Was genau schuld daran war, ist bis heute nicht ganz klar. Fest steht nur, dass Gelsinger nicht das erste Opfer von Gentherapie-Versuchen war. Vermutlich kam es zu einer Überreaktion des Immunsystems des Patienten gegenüber dem als Gen-Fähre benutzten Virus. Der heute noch oft zitierte Fall Gelsinger bedeutete für Gentherapie-Experimente einen Rückschlag, der noch ein ganzes Jahrzehnt danach spürbar war. In den USA haben die National Instituts of Health (NIH) aus diesen Erfahrungen die Empfehlung abgeleitet, Gentherapie-Experimente nur dann durchzuführen, wenn für eine gegebene Krankheit keine andere Therapie zur Verfügung steht. Auch in der Europäischen Union werden Gentherapien in der Regel nur zugelassen, wenn alle anderen Therapien versagen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es als bedenklich, dass im letzten Oktober die vom Schweizer Pharma-Konzern Novartis übernommen Firma AveXis bei der US-Zulassungsbehörde FDA einen Antrag auf Zulassung einer teuren Gentherapie namens Zolgensma für die seltene, aber tödliche Kinderkrankheit Spinale Muskelatrophie (SMA) einreichte. Wie ich vor einem Jahr auf dieser Plattform berichtet habe, gibt es aber bereits eine von der FDA wie auch von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassene und als zuverlässig anerkannte SMA-Therapie. Für die einmalige Behandlung mit Zolgensma rechnet Novartis mit Kosten von sage und schreibe vier bis fünf Millionen US-Dollar. Ist das gerechtfertigt für eine riskante Therapie, die bislang nur an 15 bis 20 Kindern getestet wurde? Legt das nicht den Verdacht nahe, der Konzern trachte danach, die Verzweiflung der Eltern SMA-kranker Kinder finanziell auszunützen? Mit diesen Fragen wird sich die US-FDA, die im Mai 2019 über die Zulassung von Zolgensma entscheiden will, befassen müssen. Gegenüber der Einschleusung fehlender Erbinformationen mithilfe von Gen-Fähren (Vektoren) bietet die eingangs erwähnte „Gen-Schere“ CRISPR/Cas9 m Prinzip den Vorteil größerer Präzision. Bei den bisherigen Ansätzen der Gentherapie wird ein beschädigtes Gen durch eine künstliche Kopie mit der richtigen Information ersetzt. Da das beschädigte Gen jedoch an seinem Ort bleibt, muss die künstliche Ersatz-Kopie an einem anderen Ort des Genoms eingebaut werden. Dort ist es dann wenig wahrscheinlich, dass das neue Gen richtig reguliert wird, das heißt zum rechten Zeitpunkt an- und abgeschaltet und dosiert wird, da diese Regulation in der Regel durch die Nachbarschaft des Gens erfolgt. Mithilfe von CRISPR/Cas9 können jedoch defekte Gene punktgenau entfernt und durch intakte ersetzt werden. Die Umgebung des Gens wird also nicht verändert. Das Problem dabei ist aber, dass Milliarden Körperzellen gleichzeitig in der richtigen Weise genetisch verändert werden müssen. Dabei können Fehler auftreten, die im schlimmsten Fall zum Ausbruch von Krebs führen können. Gerade diese Schwierigkeit könnte Genforscher dazu verleiten, CRISPR/Cas9 zuerst an der sehr viel kleineren Zahl von Keimzellen auszuprobieren. Neben Ruhmsucht könnte diese Überlegung auch hinter dem Experiment des Chinesen He Jiangkui gestanden haben. Die Organisationen der Wissenschaft sollten gemeinsam mit den Zulassungs- und Aufsichtsbehörden sowie den interessierten Firmen nach Vorkehrungen suchen, um ein solches voreiliges Vorpreschen bei einer hoch riskanten Technik zu verhindern.