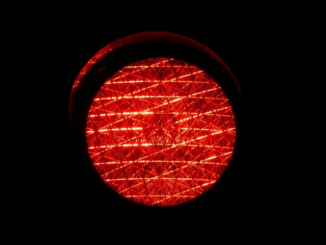Europa erlebt derzeit eine Renaissance der Industriepolitik. Zur Industriepolitik gehört es, die sektorale Entwicklung einer Volkswirtschaft durch Subventionen zu beeinflussen, es geht um staatliche Beteiligungen an Unternehmen oder Regulierungen. Industriepolitik kann auch darin bestehen, Unternehmensfusionen zur Bildung nationaler Champions zu fördern. Das sind große Unternehmen, die mit Unterstützung ihrer Heimatstaaten die Weltmärkte erobern sollen. Verbreitet ist es außerdem, ausländischen Investoren zu verbieten, heimische Unternehmen zu übernehmen, denen strategische Bedeutung zugesprochen wird.
Die schwierige Tradition der Industriepolitik in Europa
Derartige Eingriffe haben eine lange Tradition. Sie sind allerdings nicht immer erfolgreich. Frankreich gilt als Mutterland der Industriepolitik. Dort wurden besonders viele industriepolitische Initiativen unternommen. Dazu gehören die Entwicklung des Überschallflugzeugs Concorde oder der „Plan Calcul“, mit dem in den späten 1960er Jahren eine französische Computerindustrie entwickelt werden sollte, die US-Firmen wie IBM Paroli bietet. Ein teurer Fehlschlag. Fragwürdig waren auch Eingriffe bei Unternehmensübernahmen. Als der US-Konzern PepsiCo im Jahr 2005 die französische Firma Danone übernehmen wollte, intervenierte der damalige französische Präsident Jacques Chirac. Warum er das tat, blieb unklar. Für seine „strategische Joghurtpolitik“ erntete er jedenfalls viel Spott. Die Gründung des europäischen Flugzeugherstellers Airbus gemeinsam mit Deutschland hat ebenfalls Milliarden an Subventionen verschlungen, aber immerhin ist dadurch der Wettbewerb im Flugzeugmarkt verstärkt worden, und es entstand eine Industrie, die heute als konkurrenzfähig gilt. Insgesamt hat die französische Industriepolitik allerdings nicht verhindern können, dass der Industriesektor immer mehr geschrumpft ist und heute weniger als 10 % der Wertschöpfung im Land erwirtschaftet, verglichen mit beispielsweise 18 % in Deutschland.
Zwei Gründe für die aktuelle Renaissance der Industriepolitik
Dass Europa die Industriepolitik derzeit wiederentdeckt, hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens möchte Europa bis 2050 klimaneutral werden. Die Industrieproduktion zu dekarbonisieren, ohne Europa zu deindustrialisieren, ist eine große Herausforderung. Mit CO2-Steuern und Regulierungen allein wird das nicht zu erreichen sein. Zweitens haben der Überfall Russlands auf die Ukraine und das damit einhergehende Ende der russischen Gaslieferungen gezeigt, wie sehr wirtschaftliche Abhängigkeiten bei geopolitischen Konflikten zum Problem werden können.
Was die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität angeht, hatte die europäische Politik lange gehofft, durch saubere Industrien nicht nur das Klima zu schützen, sondern der europäischen Wirtschaft zusätzlich Vorteile auf den Märkten der Zukunft zu verschaffen. Vor allem in Deutschland ist die Vorstellung populär, die heimische Industrie könnte auf dem Gebiet klimaschonender Technologien eine Führungsrolle übernehmen. Bei der wichtigsten Branche des Landes, der Autoindustrie, hat das allerdings nur teilweise funktioniert. Hier hat mit Tesla ein US-Unternehmen wichtige Impulse gesetzt, auch wenn Unternehmen wie Volkswagen oder BMW jetzt nachziehen.
Nun hat die US-Regierung mit ihrem Inflation Reduction Act (IRA) den europäischen Hoffnungen auf eine Führungsrolle bei Umwelttechnologien einen weiteren Dämpfer versetzt. Dieses Gesetz stellt in den nächsten zehn Jahren 369 Mrd. US-Dollar an Subventionen für klimafreundliche Produkte und Technologien wie Elektroautos, Wärmepumpen und Solarzellen, Windräder bis hin zu Kernkraftwerken bereit. Die Förderung ist teilweise daran gebunden, dass die Güter in den USA oder in Ländern produziert werden, die ein Freihandelsabkommen mit den USA haben. Das würde Importe aus Europa benachteiligen und Anreize für europäische Unternehmen schaffen, Produktionsstandorte nach Nordamerika zu verlagern. Mittlerweile verhandeln die USA und die EU allerdings darüber, die Förderung auch für europäische Produkte zu öffnen.
In Europa wird dennoch vielfach gefordert, als Antwort auf den IRA ein neues Subventionsprogramm aufzulegen, finanziert vorzugsweise durch neue gemeinsame Schulden. Derartige Forderungen sind voreilig. Sie überschätzen die Vorteile für den Investitionsstandort USA durch IRA, sie vernachlässigen, dass Europa bereits umfangreiche Programme zur Subventionierung sauberer Technologien aufgelegt hat, und sie lenken von dringenderem Handlungsbedarf in anderen Bereichen ab. Darüber hinaus spricht die makroökonomische Lage mit hoher Inflation gegen neue schuldenfinanzierte Staatsausgaben.
Die Wirkung des amerikanischen Inflation Reduction Act
Tatsächlich besteht die wichtigste Wirkung vom IRA darin, die Treibhausgasemissionen zu senken. Das ist auch aus europäischer Sicht sehr zu begrüßen. Der IRA ist weniger ein Programm zur allgemeinen Stärkung des Investitionsstandorts USA, und das aus zwei Gründen. Erstens bringt IRA den in den USA tätigen Unternehmen nicht nur Subventionen, sondern auch höhere Steuerlasten: Eine Mindeststeuer für Großunternehmen sowie eine neue Steuer auf Aktienrückkäufe. Letztlich soll der IRA durch Steuererhöhungen mehr als vollständig gegenfinanziert werden. Zweitens ist es fraglich, ob Investitionen in Fabriken für Solarpaneele, Wärmepumpen oder Autobatterien, die etablierte Technologien einsetzen, nachhaltig sind. Es ist nicht erkennbar, warum die USA in diesen Bereichen komparative Vorteile haben sollten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Fabriken bleiben, solange es Subventionen gibt, sie aber nach dem Auslaufen der Förderung wieder abwandern. Möglicherweise setzt die US-Regierung dennoch auf diese Karte, weil man im kommenden Präsidentschaftswahlkampf mit dem Argument punkten will, man habe in den USA Industriejobs geschaffen. Nachhaltigere Wirkung dürfte die Förderung der Erforschung, Entwicklung und Skalierung von neuen klimafreundlichen Produkten und Technologien entfalten, aber das steht beim IRA nicht im Mittelpunkt.
Aktuelle Vorteile der USA als Investitionsstandort gegenüber Europa haben primär andere Gründe: Insbesondere eine preisgünstige und sichere Energieversorgung, geringere Steuern und Abgaben, den direkten Zugang zu Absatzmärkten in den USA und bei US-Freihandelspartnern wie Kanada und lateinamerikanischen Ländern und nicht zuletzt die Sicherheit angesichts geopolitischer Spannungen und der Bedrohung der EU durch Russland.
Welcher Handlungsbedarf besteht vor diesem Hintergrund für die europäische und deutsche Politik, und welche Rolle spielen industriepolitische Instrumente? Grundsätzlich besteht ein Problem staatlicher Industriepolitik darin, dass komparative Vorteile am Markt entdeckt werden müssen. Politische Entscheidungen, bestimmte Sektoren zu fördern, können sich als teurer Flop erweisen, wenn sich daraus nicht Industrien entwickeln, die nach einer Anlaufphase auf eigenen Beinen stehen und wettbewerbsfähig sind.
Staatliche Eingriffe können bei der Dekarbonisierung sinnvoll sein
Bei der Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität gibt es dennoch verschiedene Argumente für Staatseingriffe. Dabei geht es nicht so sehr um die direkte Klimaschutzwirkung. Dafür können CO2-Preise oder Regulierungen hinreichende Anreize schaffen. Wichtiger sind positive Externalitäten von Forschung und Innovationen. Anstrengungen einzelner Unternehmen für Forschung, Entwicklung und die Verbesserung von Produktionsverfahren mit dem Ziel der Kostensenkung kommen nicht nur ihnen selbst, sondern auch anderen Unternehmen zugute, die von ihnen lernen. Soweit das zutrifft, wird ohne staatliche Förderung zu wenig in diese Aktivitäten investiert. Beispiele für derartige Kostensenkungen bieten die Solar- und Windenergie. Die Produktionskosten für neue Photovoltaikanlagen sind im Zeitraum zwischen 2010 und 2020 um rund 90 % gefallen. Windturbinen haben sich um etwa die Hälfte verbilligt. Ähnliche Effekte kann man im Bereich der Wasserstoffwirtschaft oder bei der dekarbonisierten Stahlproduktion erwarten.
All dies spricht dafür, vor allem die Forschung zu klimaschonenden Technologien und die Entwicklung und Herstellung klimafreundlicher Produkte mit der neuesten Technologie zu fördern, möglicherweise auch im Rahmen staatlicher Beschaffung. Beispiele dafür bieten die US-Militärausgaben. Subventionswettbewerbe um die Ansiedlung von Batteriefabriken, die mit etablierten Produktionsverfahren arbeiten, sind mit Forschungsexternalitäten allerdings nicht zu rechtfertigen. Dem könnte man entgegenhalten, eine Abhängigkeit von Importen bei so wichtigen Gütern wie Batterien in einer Zeit wachsender geopolitischer Spannungen vermeiden zu wollen. Dabei wird übersehen, dass geopolitische Konflikte mit den USA, die zu einem Stopp von Batterieexporten nach Europa führen würden, kaum zu erwarten sind.
Ein weiteres Argument für staatliche Förderung kann darin liegen, dass es ohne diese Förderung zu Carbon Leakage, also der Verlagerung der Industrieproduktion und damit der Emission von Treibhausgasen in andere Regionen kommen kann. Wenn in Europa beispielsweise die herkömmliche Stahlproduktion durch hohe CO2-Preise verteuert wird, ist es naheliegend, die Produktion in andere Regionen mit weniger restriktiver Klimapolitik zu verlagern. Dadurch würde die EU deindustrialisiert, und für den Klimaschutz wäre nichts gewonnen. Für Importe in den Europäischen Binnenmarkt soll künftig ein Grenzausgleich gelten, der Wettbewerbsnachteile für in der EU erzeugte, klimafreundlich erstellte Produkte nivelliert. Ob das so umsetzbar ist, muss sich noch zeigen, weil andere Länder den Grenzausgleich als protektionistische Maßnahme ansehen könnten. Exporte aus der EU in Drittländer verlieren aber auf jeden Fall an Wettbewerbsfähigkeit. Hier wäre es möglich, bei besonders betroffenen Produkten wie Stahl für eine Übergangszeit eine Förderung vorzusehen. Auf Dauer lohnt es sich für Europa allerdings nicht, die Welt mit grünem Stahl zu versorgen, wenn andere Länder, die keinen Klimaschutz betreiben, herkömmlichen Stahl billiger erzeugen. Das unterstreicht die Grenzen europäischer Alleingänge in der Klimapolitik.
Klimaschonende Technologien werden darüber hinaus nur dann von privaten Investoren entwickelt, wenn sie für die Zukunft auf Rahmenbedingungen vertrauen können, unter denen diese Technologien wettbewerbsfähig sind und nachgefragt werden. Beispielsweise wird man nicht in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen einsteigen, wenn man befürchtet, dass es an Ladeinfrastrukturen oder hinreichend ausgebauten Stromnetzen fehlen wird. Umgekehrt werden sich für Ladesäulen kaum Investoren finden, wenn unklar ist, ob genug Elektroautos kommen. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, für glaubwürdige Rahmenbedingungen zu sorgen.
Der europäische Weg: Verursacher bepreisen
Wie kann sinnvolle Industriepolitik nach diesen Prinzipien gestaltet und finanziert werden? Beim Klimaschutz setzt die EU bislang teilweise auf andere Konzepte als die USA. In Europa ist der Handel von CO2-Emissionszertifikaten das wichtigste Instrument. Es orientiert sich am Verursacherprinzip. Die Kosten der Umweltschädigung werden denjenigen angelastet, von denen sie ausgehen. Die USA verfolgen mit dem IRA ein anderes Konzept: Statt das Verursachen von Klimagasemissionen zu belasten, wird die Vermeidung von Emissionen subventioniert.
Der Nachteil der US-Strategie besteht darin, dass man die Subventionen mit Steuereinnahmen aus anderen Quellen finanzieren muss, während in Europa der Staat bei der Anwendung des Verursacherprinzips sogar noch Einnahmen erzielt. Allerdings belastet die europäische Klimapolitik für sich genommen die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen auf den globalen Märkten, während die US-Subventionspolitik diesen Nachteil vermeidet. Deshalb versucht die EU, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft durch Ausgleichsmaßnahmen wie den CO2-Grenzausgleich zu schützen.
Nun sind Subventionen auch der europäischen Klimapolitik nicht fremd. Gerade Deutschland hat die Wind- und Solarenergie mit Milliardenbeträgen gefördert. Die EU hat mit dem Fonds Next Generation EU (NGEU) erst kürzlich ein umfangreiches Subventionsprogramm zur digitalen und grünen Transformation der Wirtschaft aufgelegt. Dessen Umfang liegt nach aktuellen Preisen bei gut 800 Mrd. Euro, die schon bis 2026 ausgegeben werden sollen. Mindestens 37 % dieser Mittel, also 296 Mrd. Euro, fließen in die grüne Transformation. Dieser Anteil könnte vor dem Hintergrund der verstärkten Konkurrenz mit den USA erhöht werden. Das gilt auch für die Mittel, mit denen direkt die Dekarbonisierung der Industrieproduktion gefördert wird. Allerdings bestehen schon heute Engpässe beim Vorweisen sinnvoller Projekte, weniger bei der Verfügbarkeit von Fördermitteln. Deshalb fließen die NGEU-Gelder zu einem erheblichen Teil in Projekte, die von den Mitgliedstaaten ohnehin finanziert worden wären. Zögerliche Nutzung der Fördermittel kann aber auch an übermäßig bürokratischen Antragsprozessen liegen. Das spricht dafür, eine Umstellung der Förderung auf steuerliche Instrumente wie beschleunigte Abschreibungen oder Steuergutschriften zu prüfen.
Die Mittel aus NGEU fließen vornehmlich in EU-Staaten mit niedrigerem Einkommensniveau, hoher Arbeitslosigkeit und hohen Schulden. Italien als größter Empfänger erhält aus dem Fonds rund 200 Mrd. Euro an Zuschüssen und Darlehen, Spanien rund 150 Mrd. Euro. Damit relativiert sich die Sorge, bislang noch niedriger verschuldete Staaten wie Deutschland oder die Niederlande könnten ihrer Industrie durch größere Subventionen Vorteile verschaffen.
Hier könnte man einwenden, die Regeln der EU-Beihilfenkontrolle hinderten die Mitgliedstaaten daran, mit den USA im Wettbewerb um einzelne Unternehmensansiedlungen konkurrieren zu können. In der Tat sind Forderungen aufgekommen, die Regeln der EU-Beihilfenkontrolle zu lockern. Dazu ist zu sagen, dass es vor allem bei größeren Projekten mit hoher Sichtbarkeit leicht zu einem Überbietungswettbewerb kommen kann. Dabei wird vor allem derjenige geschädigt, der am Ende den Zuschlag erhält, weil die Subvention höher ist als der Nutzen, den das Land von der Ansiedlung hat. Darüber hinaus würden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur die Konkurrenz mit den USA, sondern auch die der Mitgliedstaaten untereinander die Subventionen in die Höhe treiben. Es besteht ein gemeinsames Interesse der EU-Mitgliedstaaten daran, vor allem Letzteres zu verhindern. Diese Argumente sprechen dafür, die EU-Beihilfenkontrolle nicht so weit zu lockern, dass alle Barrieren für Subventionswettläufe fallen. Spielräume für gezielte, an Innovationen orientierte Industriepolitik sollten aber vorhanden sein.
Über die Dekarbonisierung hinausdenken
Europas Industriepolitik sollte sich allerdings nicht auf Fördermaßnahmen für die Dekarbonisierung beschränken. Die Debatte über die Reaktion auf den IRA lenkt davon ab, dass es dringend notwendig ist, an anderen Dimensionen der Wettbewerbsfähigkeit Europas zu arbeiten und Versäumnisse aufzuholen. An erster Stelle steht hier die Energiepolitik. Eine preiswerte und sichere Energieversorgung erfordert es, die europäischen Energiemärkte stärker zu integrieren, Energienetze, erneuerbare Energien und Kernkraft auszubauen sowie die Forschung auf diesen Gebieten zu fördern. Gebraucht wird außerdem ein neuer Regulierungsrahmen, der die Entstehung einer Plattformökonomie im Energiesektor ermöglicht, in dem private Haushalte und Unternehmen gleichzeitig als Konsumenten und Erzeuger von Energie agieren.
Europa hat außerdem große Rückstände im Bereich der Digitalisierung. Die Datenschutz-Grundverordnung behindert an vielen Stellen die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, ohne damit berechtigten Schutzinteressen zu dienen. Die EU-Staaten bürden ihren Unternehmen darüber hinaus unnötige Lasten auf. Das gilt nicht nur für Steuern und Abgaben, sondern auch immer komplexere Berichts- und Überwachungspflichten wie etwa die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder die Lieferkettenkontrolle.
Das wichtigste Versäumnis liegt allerdings darin, dass die EU ihre größte Stärke, den Europäischen Binnenmarkt, zu zögerlich weiterentwickelt. Grenzüberschreitende Geschäfte sind in der EU nach wie vor oft mit erheblichem Aufwand verbunden, so dass viele Unternehmen ihr Glück lieber in den USA versuchen, denn dort ist schnelles Wachstum wegen der Marktgröße einfacher. All dies erfordert politische Detailarbeit abseits vom Rampenlicht der Öffentlichkeit, aber diese Arbeit ist für die wirtschaftliche Zukunft Europas wichtiger als Debatten über neue Subventionstöpfe.
Clemens Fuest
Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft
Präsident des ifo Instituts
Erschienen unter dem Titel „Welche Industriepolitik Europa wirklich braucht“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Februar 2023