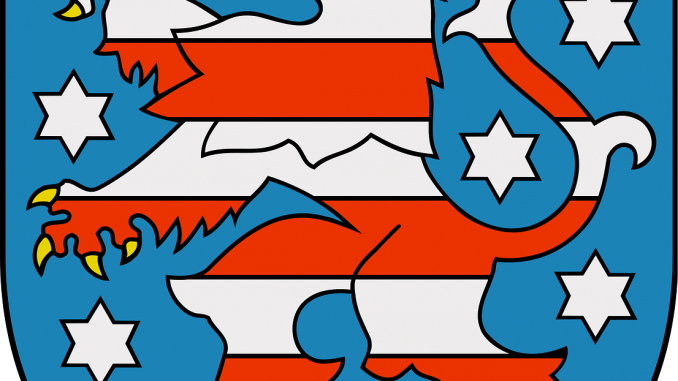
Mitte August 2020 überraschte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Öffentlichkeit mit der Idee, den Ministerpräsidenten des Freistaats direkt in einer Urwahl durch die Wähler bestimmen zu lassen. „Dann bräuchten wir übrigens nur einen Wahlgang und hätten sofort Klarheit“, sagte Ramelow laut Thüringer Allgemeine (19.8.2020). Der Ministerpräsident reagierte damit auf einen nach seiner Einschätzung wenig „kühnen“ Vorschlag der CDU-Fraktion zur Präzisierung des Artikel 70 Abs. 3 ThürVerf, der die Wahl des Ministerpräsidenten durch den Thüringer Landtag regelt. Damit schlug er nichts weniger vor, als das parlamentarische System hin zu einem präsidentiellen umzubauen.
Lässt sich aus dem Zitat noch ableiten, dass Ramelow vermutlich eine Urwahl ohne Stichwahlen vorschwebt, so blieben weitere Einzelheiten völlig im Dunkeln. Der Vorschlag blieb ohne Widerhall. Das ist bedauerlich, denn zum einen hegen die Bürger für eine Direktwahl des Ministerpräsidenten eine verbreitete Sympathie. Das Meinungsforschungsinstitut INSA ermittelte unmittelbar nach Ramelows Vorschlag eine Zustimmung von immerhin71 Prozent. Er ist quer über alle Altersgruppen und bei Wählern aller im Landtag vertretenen Parteien mehrheitsfähig. Die ausgesprochene Ablehnung fiel mit gut 8 Prozent überschaubar aus.
Vor allem aber lohnte es sich, darüber nachzudenken, ob ein präsidentielles System auf Landesebene mittelfristig eine Antwort auf Landtagswahlergebnisse sein könnte, bei denen drei oder mehr Fraktionen benötigt werden, um einen Ministerpräsidenten im Landtag zu wählen und seine Regierung parlamentarisch abzusichern. Nach den Thüringer Landtagswahlen am 27. Oktober 2019 hat sich gezeigt, welche Verwerfungen sich ergeben können, wenn sich Wahlergebnisse nicht mehr nach den gewohnten politischen Mustern verarbeiten lassen. Die aktuelleren Meinungsumfragen legen den Schluss nah, dass die Wähler sich von diesen Schwierigkeiten wenig beeindrucken lassen und sich durch Neuwahlen nichts Entscheidendes ändern könnte.
Blockaden im parlamentarischen System am Beispiel Thüringens
Die zwei Ministerpräsidentenwahlen im Thüringer Landtag am 5. Februar und 4. März 2020 und der unterhalb der Schwelle einer förmlichen Duldung oder Tolerierung zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU-Fraktion Ende Februar 2020 vereinbarte „Stabilitätsmechanismus“ zeigen beispielhaft, wie das parlamentarische System an Grenzen stößt beziehungsweise sich von seiner eigentlich gedachten Funktionsweise entfernt. Die läuft darauf hinaus, dass eine inhaltlich hinreichend konturierte Mehrheit den Ministerpräsidenten wählt und mit seiner Regierung ihr Programm umsetzt, während die parlamentarische Kontrollfunktion nicht ausschließlich, aber doch überwiegend durch die Oppositionsfraktionen wahrgenommen wird. Art. 59 ThürVerf hebt sie dementsprechend ausdrücklich hervor. Überdies formuliert die Opposition die politischen Alternativen zur Regierungspolitik.
Nach den Regeln der Thüringer Landesverfassung waren und sind weder die zwei Ministerpräsidentenwahlen noch das parlamentarische Arrangement zwischen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung und der CDU-Fraktion zu beanstanden. Und doch fallen die Mängel ins Auge. Zwar entspricht es den Regeln und der Logik des parlamentarischen Systems, dass der Landtag bei der Aufstellung von Kandidaten und der Wahl des Ministerpräsidenten frei ist. Angesichts der Personalisierung der Wahlkämpfe und der Bedeutung der Spitzenkandidaten für die Parteien dürfte es für einen erheblichen Teil der Wähler jedoch zumindest irritierend sein, wenn am Ende Personen in die Staatskanzlei einziehen, die niemand auf der Rechnung hatte. Das Risiko wächst mit der Anzahl der Parteien, die den Sprung ins Parlament schaffen.
Je mehr Partner zur Bildung einer Koalition erforderlich sind, umso schlechter sind die Aussichten für die Bürger, dass sie auf der sachpolitischen Ebene bekommen, was sie mit der Stimmabgabe zugunsten einer Partei angestrebt haben. Das ist verkraftbar, solange die Schnittmengen der Programme auch bei mehreren Koalitionspartnern hinreichend breit sind und so etwas wie ein Profil ablesbar ist; so wie zuletzt bei der von den Bürgern mit einer Mehrheit ausgestatteten rot-rot-grünen Regierungskoalitionen von Ende 2014 bis 2019. Wird für erfolgreiche Abstimmungen im Parlament jedoch ein weiterer Partner mit im Wesentlichen entgegengesetzten Zielen benötigt, wird jener Teil der Landespolitik weitgehend stillgestellt, der die politische Gestaltung entlang inhaltlicher Leitvorstellungen betrifft. Das ist aktuell die Folge des erwähnten „Stabilitätsmechanismus“.
Die Gestaltungsmöglichkeiten verengen sich nochmals, wenn politische Optionen mit mehr oder minder harten Tabus belegt werden. Das gilt für die LINKE, die SPD und Bündnis´90/Die Grünen für jedwede Kooperation mit der AfD, in der sie eine Art faschistischen Wiedergänger sehen. Die CDU wiederum „lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab“, wie es ein Parteitag im Dezember 2018 formulierte. Im Nachgang zur Wahl des FDP-Politikers Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten hat die Führung der CDU Deutschlands den Beschluss dahingehend interpretiert, dass koalitionsähnliche Formen der Zusammenarbeit nicht allein Duldung oder Tolerierung sind, sondern auch die Hinnahme von an keinerlei Bedingungen geknüpfter Stimmen der AfD, sofern sie wahlentscheidend sind.
Genauso energisch hat die Bundesführung der CDU nach den Thüringer Landtagswahlen am 27. Oktober 2019 alle Versuche des damaligen Fraktions- und Landesvorsitzenden der Thüringer Union, Mike Mohring, zurückgewiesen, mit Bodo Ramelow über Formen der Kooperation ins Gespräch zu kommen, die eine Regierungsbildung unter Verzicht auf herkömmliche Koalitions- oder Tolerierungsmodelle ermöglichen sollte. Noch bei der Wahl Ramelows zum Ministerpräsidenten war es für die CDU Deutschlands und im Wesentlichen auch für die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag schließlich eine nicht verhandelbare Bedingung, dass er als Politiker der LINKEN ohne Stimmen von CDU-Abgeordneten ins Amt gelangt, so wie es im 3. Wahlgang schließlich auch geschah.
Wie hart diese Tabus mittel- und langfristig sind, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Auf absehbare Zeit dürften sie jedoch Bestand haben. Das zeigen bereits die linkerseits äußerst erregten Reaktionen auf das Bekenntnis des Ministerpräsidenten Ramelow, einem Kandidaten der AfD mit seinen Stimmen in das Amt des Landtagsvizepräsidenten verholfen zu haben; wohlgemerkt einer Funktion, die der AfD-Fraktion zustand. Die AfD ihrerseits vermag es nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz bisher nicht, sich glaubhaft von rechtsextremen Personen und Positionen abzugrenzen. Im Gegenteil, ihren formal aufgelösten „Flügel“ stuft das Amt inzwischen als erwiesene extremistische Bestrebung ein. Gleiches gilt für Teilorganisationen der LINKEN allerdings auch.
Festigkeit und Reichweite insbesondere des über der AfD liegenden Tabus haben jenseits der Personalfragen erhebliche Auswirkungen auf die parlamentarische Sacharbeit. Rot-Rot-Grün und die CDU-Fraktion haben sich in ihrem „Stabilitätsmechanismus“ darauf verständigt, bis zur Verabschiedung des Landeshaushalts 2021 nicht mit wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Rot-Rot-Grün wie die CDU verzichten damit einstweilen auf die rechnerische Möglichkeit, bei entsprechender inhaltlicher Übereinstimmung eigenen Anträgen mit Stimmen der FDP und der AfD eine Mehrheit zu verschaffen. Der linke Stratege und Chef der Staatskanzlei, Benjamin Immanuel Hoff, hatte diese Möglichkeit noch im Januar 2020 ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Die CDU-Fraktion hatte sich etwa zeitgleich auf die Oppositionsstrategie festgelegt, in Sachfragen mit wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Ob es nach dem Gang der Ereignisse dabei bleibt, dürfte eine offene Frage sein.
Das Beispiel des 7. Thüringer Landtags zeigt, dass die Kreationsfunktion des Parlaments beeinträchtigt ist, wenn auch nicht verfassungsrechtlich, so doch politisch. Gleiches gilt für die Gesetzgebungsfunktion, sofern es dauerhaft bei der Selbstbindung nach Art des „Stabilitätsmechanismus“ bleibt. Die parlamentarische Kontrollfunktion leidet keine Not, sondern sie ist angesichts der fehlenden parlamentarischen Mehrheit der Regierung eher gestärkt. Hinsichtlich der Repräsentationsfunktion des Landtags hängt die Einschätzung davon ab, wie Repräsentation verstanden wird. Am Grundsatz, dass jeder Abgeordnete alle Bürger vertritt und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden ist, ändert sich selbstverständlich nichts. Stellt man jedoch in Rechnung, dass die Abgeordneten auch als Vertreter von Parteien gewählt werden und parlamentarische Aushandlungsprozesse nicht zuletzt der Akzeptanz politischer Herrschaft dienen, sieht es anders aus. Dann ist es problematisch, wenn gegenüber einem Teil der Abgeordneten politisch notwendige Abgrenzung in prinzipielle Ausgrenzung umschlägt.
Direktwahl und Abwahl des Ministerpräsidenten
Doch welche dieser Schwierigkeiten lassen sich durch einen Wechsel von einem parlamentarischen zu einem präsidentiellen System überhaupt überwinden und welche neuen, möglicherweise größeren würde man sich damit einhandeln?
Relativ eindeutig scheint der Fall bei der Direktwahl des Ministerpräsidenten selbst zu liegen. Probleme wie bei den beiden parlamentarischen Thüringer Ministerpräsidentenwahlen im ersten Quartal 2020 wären ausgeschlossen. Der Landtag wäre seine gewichtigste Kreationsfunktion schlicht los, der Ministerpräsident hätte eine direkte Legitimation durch das Volk. Damit sie überzeugend ausfällt, empfiehlt sich eine Stichwahl, wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat eine Mehrheit hinter sich versammeln kann. Neben den Landtagswahlen und den Möglichkeiten des Bürgerantrags und der Volksgesetzgebung erhielten die Bürger ein weiteres Instrument der unmittelbaren Einflussnahme. Das wäre ein demokratischer Zugewinn und zudem eine konsequente Antwort auf die Ausrichtung der Wahlkämpfe auf Spitzenkandidaten.
Wie unabhängig ein solcher Ministerpräsident vom Parlament wäre, ist damit allerdings nicht ausgemacht. Werden für mögliche Stichwahlen informelle „Koalitionen“ gebildet, so ist dieser Ministerpräsident bei der Bildung einer Regierung zumindest politisch bereits gebunden. Sähe die Verfassung überdies eine Bestätigung des von ihm gebildeten Kabinetts oder der einzelnen Minister vor – der Wahl Beigeordneter in den Kommunalvertretungen nicht unähnlich –, wäre die Unabhängigkeit weiter eingeschränkt. Der Abstand zu den Zwängen einer Regierungsbildung im parlamentarischen System wäre im Grund gering.
Die Vorstellungen, die skizzierten Schwierigkeiten und parteipolitischen Tabus ließen sich durch eine freiere Regierungsbildung überwinden, hinge also sehr von der Ausgestaltung ab. Je freier ein direkt gewählter Ministerpräsident bei der Berufung seines Kabinetts ist, desto eher wäre er etwa in der Lage, eine in Thüringen um die Jahreswende 2019/20 diskutierte „Expertenregierung“ zu berufen, sie sich nicht unmittelbar auf eine parlamentarische Mehrheit stützen kann und muss.
Unabhängiger kann ein direkt gewählter Ministerpräsident insoweit agieren, als das konstruktive Misstrauensvotum, also die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten durch den Landtag, als ultimatives Druckmittel des Landtags gegenüber der Regierung entfiele. Es wäre schlicht systemwidrig. Ein vom Volk gewählter Ministerpräsident könnte auch nur vom Volk wieder abgesetzt werden. Unmöglich ist das nicht. Analog zu den Regelungen der Thüringer Kommunalordnung könnte der Landtag das Recht erhalten, ein Abwahlverfahren einzuleiten. Wie wirksam dieses Mittel ist, hinge wiederum von den erforderlichen parlamentarischen Mehrheiten und den Konsequenzen für das Parlament selbst ab.
Ginge man von der Gleichzeitigkeit der Ministerpräsidenten- und der Landtagswahl aus, um Dauerwahlkämpfe zu vermeiden, wäre die Auflösung des Landtags im Falle einer erfolgreichen Abwahl die logische Konsequenz. Zwingend ist diese Parallelität nicht. Unter Verweis auf die Eigenständigkeit der Regierung und des Parlaments kann man ebenso für die grundsätzliche Entkoppelung der Ministerpräsidenten- und der Landtagswahlen eintreten. Auf der kommunalen Ebene ist dies für Landräte und Bürgermeister einerseits und der Kreistage beziehungsweise Gemeinde- und Stadträte andererseits lange üblich.
Nicht übersehen werden sollte, dass die Direktwahl des Ministerpräsidenten Auswirkungen auf die Landtagswahlen selbst haben könnte. Sperrklauseln wie die 5 %-Klausel zu den Bundestags- und Landtagswahlen sind wiederholt Gegenstand der Verfassungsrechtsprechung gewesen. Da sie die Chancengleichheit der Parteien und die Wahlrechtsgleichheit einschränken, bedürfen sie einer Rechtfertigung von Gewicht. Für das Bundesverfassungsgericht ist dies vor allem die „Bildung einer stabilen Mehrheit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung und deren fortlaufende Unterstützung“, wie es 2014 in seiner Entscheidung gegen eine Sperrklausel für die Wahlen zum Europäischen Parlament ausgeführt hat (2 BvE 2/13 v. 26.2.2014). Mit der Urwahl des Ministerpräsidenten entfiele ein wesentliches und gegebenenfalls das tragende Argument für die Sperrklausel. Das Risiko wüchse, sich eine weitere parteipolitische Zersplitterung des Landtags einzuhandeln.
Die Frage, ob ein präsidentielles System dem Homogenitätsgebot des Art. 28 Grundgesetz entspricht, ist bisher mangels Anlass noch nicht Gegenstand vertiefter Prüfung durch die Verfassungsgerichte gewesen. Es gibt allerdings starke Argumente dafür. Während die Weimarer Reichsverfassung (Art. 17 WRV) noch festhielt, „die Landesregierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung“, fehlt dieser Passus im Grundgesetz. Die verfassungsmäßige Ordnung der Länder muss lediglich „den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaats im Sinne dieses Grundgesetzes“ entsprechen. 1959 erwähnte das Bundesverfassungsgericht in anderem Zusammenhang, dass „die Form des parlamentarischen Regierungssystems, in dem die parlamentarische Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament im Misstrauensvotum Ausdruck findet, für die Landesverfassungen nicht zwingend vorgeschrieben“ ist (BVerfGE 9,268, Rdnr. 281).
Auch aus der „Ewigkeitsklausel“ der Thüringer Landesverfassung (Art. 83 Abs. 3 ThürVerf) ergeben sich keine Gründe, die einem solchen Systemwechsel entgegenstünden. Die Landesverfassung könnte durch den Landtag mit Zweidrittelmehrheit oder im Wege der Volksgesetzgebung geändert werden. Im Freistaat Bayern hatte die ÖDP letzteres 2012/13 über ein Volksbegehren versucht, war jedoch an mangelnder Unterstützung gescheitert.
Der direkt gewählte Ministerpräsident und der Landtag
Beim Wechsel zu einem präsidentiellen System geht der Landtag zunächst als „Verlierer“ vom Platz, weil er eine seiner bisher wichtigsten Funktionen an das Volk abgäbe. Die Frage ist, ob dem ein entsprechender „Gewinn“ bei der Gesetzgebungs- und Kontrollfunktion gegenübersteht und die Gesetzgebung weniger gehemmt wäre, als am Thüringer Beispiel oben ausgeführt. In der Theorie würde sich die Verfassung wieder näher der klassischen Gewaltenteilung annähern, bei der sich Exekutive und Legislative gegenüberstehen. Der Nutzen, den der Landtag daraus ziehen könnte, hängt allerdings von der konkreten verfassungsrechtlichen Ausgestaltung und dem politischen Willen der Abgeordneten ab.
Grundsätzlich könnte das Parlament in seiner Gesamtheit freier agieren, weil nicht jegliche Eigenwilligkeit und jeder größere Dissens regierungstragender Fraktionen untereinander mit der Regierung auch zu einer Regierungskrise führen kann. Der damit verbundene Disziplinierungsdruck, der insbesondere bei knappen Mehrheiten entsteht, entfiele. Das spricht zunächst einmal für eine Belebung der parlamentarischen Kontroversen. Die ist jedoch kein Selbstzweck, denn am Ende beurteilen die Bürger das politische System auch nach seiner Fähigkeiten, die vorhandenen Probleme zu lösen und das Land weiterzuentwickeln. Jede Regierung wird selbst dann daran interessiert sein müssen, sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützen zu können, wenn ihr politisches Überleben nicht im gleichen Maße wie im parlamentarischen System von ihr abhängt.
Je nach Wahlergebnis wird auch ein direkt gewählter Ministerpräsident versuchen, die erforderliche Zahl an Parteien beziehungsweise Fraktionen einzubinden, um einen Gleichklang zwischen Regierung und parlamentarischer Mehrheit herzustellen. Das wirkte in der praktischen politischen Arbeit in Richtung einer Parlamentarisierung des präsidentiellen Systems, bei dem sich das Verhältnis zwischen Mehrheitsfraktionen und Regierung nicht unähnlich gestalten würde wie im parlamentarischen System. Spannender wird es, wenn sich im Landtag keine entsprechenden Koalitionen bilden lassen und eine gegenläufige Mehrheit der Regierung ihren gesetzgeberischen Willen theoretisch aufzwingen könnte.
Dabei handelt es sich allerdings um eine voraussetzungsreiche Vorstellung. Zum einen müssten die Fraktionen bereit sein, gegenläufige Mehrheiten parlamentarisch überhaupt zu nutzen. Zum anderen wäre diese Mehrheit anders als eine regierungstragende von den Möglichkeiten abgeschnitten, sich der Ressourcen und Informationen des Regierungsapparats zu bedienen. Es dürfte einer solchen Mehrheit umso schwerer fallen, dem Initiativrecht der Regierung parlamentarisch etwas entgegenzusetzen, je komplexer die zur Debatte stehenden Materien sind. Eine personelle und finanzielle Stärkung des Landtags beziehungsweise der Fraktionen wäre erforderlich, um diesen Nachteil auszugleichen.
Ist dies gewährleistet, sind allerdings etliche landespolitische Themen denkbar, bei denen das Parlament Vorgaben formulieren und Stoppschilder setzen kann. In praktisch allen wesentlichen Zuständigkeitsbereichen deutscher Länder kommt es regelmäßig zu grundsätzlichen parlamentarischen Kontroversen, die in unterschiedlichen politischen Überzeugungen wurzeln. Insoweit führt das gelegentlich zu lesende Argument in die Irre, auf Landesebene könne man über ein präsidentielles System nachdenken, weil es am Ende nur um eine höhere Art Kommunalpolitik gehe.
Die Aussichten auf einen kraftvoll auftretenden Landtag könnten sich freilich schnell eintrüben, wenn sich durch einen etwaigen Wegfall der Sperrklausel weitere politische Kleinstgruppen in den Landtag einzögen. Einerseits würden sich für die Regierung damit die Chancen erhöhen, mit einzelnen Abgeordneten oder Fraktionen politische Koppelgeschäfte auszuhandeln. Andererseits erhielten die so Umworbenen dadurch erhebliche Macht und hätten die Möglichkeit, Sonderinteressen durchzusetzen, die nicht zwingend am Wohl des Landes ausgerichtet sein müssten.
Denkbar ist auch, dass das Abstimmverhalten des Landes im Bundesrat auf diesem Basar landen würde, sofern der Ministerpräsident in der Länderkammer nicht mehr durch die übliche Bundesratsklausel in einem Koalitionsvertrag gebunden wäre. Sie stünde als argumentative Rückzugslinie unter Umständen nicht mehr zur Verfügung. Die Frage, ob eine Direktwahl den Ministerpräsidenten im Bund eher schwächt oder stärkt, hängt von den jeweiligen landespolitischen Konstellationen ab. Sie entscheiden letztlich auch darüber, ob der Landtag seinen Einfluss auf die Bundesratspolitik des Landes ausbauen kann oder nicht.
Schlussfolgerungen
Zurück zur Ausgangsfrage: Löst die Direktwahl des Ministerpräsidenten also Probleme, in die das parlamentarische System durch Landtage mit aktuell bis zu sechs Fraktionen geraten kann? Die kurze Betrachtung ergibt keinen eindeutigen Befund. Für die Bürger bedeutet die Direktwahl des Ministerpräsidenten einen Zugewinn an demokratischer Mitbestimmung. Die Ausrichtung von Wahlkämpfen auf einen Spitzenkandidaten hätte eine saubere verfassungsrechtliche Entsprechung. Bei davon zeitlich getrennten Landtagswahlen würde die Wahl eines Spitzenkandidaten wiederum als Motiv entfallen und die Wähler könnten sich eindeutiger an Inhalten statt Personen orientieren.
Der Spielraum für eine von den parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen unabhängige Regierungsbildung hängt von zwei Faktoren ab: Auf der verfassungsrechtlichen Ebene ist er nur dann wirklich groß, wenn der direkt gewählte Ministerpräsident nicht auf die Bestätigung seiner Minister oder des gesamten Kabinetts durch den Landtag angewiesen ist. Auf der politischen Ebene hängt er von der Selbstbindung durch mehr oder minder formalisierte Vereinbarungen ab, die vor allem für Stichwahlen getroffen werden dürften. Je enger der verfassungsrechtliche oder politische Rahmen ist, desto mehr Absprachen müssen getroffen werden, bei denen Unvereinbarkeitsbeschlüsse berührt sein könnten.
Zugespitzt könnte man sagen: Alle Mechanismen, die wünschenswert sind, um einen Gleichklang zwischen Regierung und parlamentarischer Mehrheit herzustellen und damit die Leistungsfähigkeit des Systems zu fördern, widerstreiten dem Ziel, eine Regierungsbildung ohne Rücksicht auf parlamentarische Blockaden, Selbstblockaden und Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu ermöglichen. Und dennoch: Es ist nicht dasselbe, ob eine Fraktion im Parlament den Ministerpräsidenten durch Wahl legitimiert oder an der Regierung eines Ministerpräsidenten mitwirkt, der bereits unmittelbar vom Volk legitimiert ist.
Und der Landtag? Er verlöre mit dem Recht zur Wahl des Ministerpräsidenten eine seiner wesentlichen Kompetenzen, während Vorteile nicht in gleicher Eindeutigkeit zu erkennen sind. Kann sich die Regierung auf eine parlamentarische Mehrheit stützen, ändert sich im politischen Alltag nicht sonderlich viel. Das Nachsehen hätte in diesem Fall die Opposition, da Streit unter den Koalitionsfraktionen die Regierung nicht mehr gefährdet und ihr überdies das Instrument des konstruktiven Misstrauensvotums nicht mehr zur Verfügung stünde.
Kann sich die Regierung nicht auf eine parlamentarische Mehrheit stützen, hat der Landtag erheblichen Einfluss auf den Spielraum der Regierung und kann ihr über Gesetze, nicht zuletzt den Haushalt, den Rahmen und die Richtung vorgeben. Doch was wäre wirklich gewonnen? Denn genau das könnte eine parlamentarische Mehrheit im parlamentarischen Regierungssystem gegenüber einer Minderheitsregierung auch jetzt schon. Insoweit ist in beiden Fällen der politische Wille entscheidend und für den Landtag kein wirklicher Vorteil ersichtlich.
Während aus der Binnensicht des Parlaments also kein stichhaltiges Motiv für den Wechsel zum präsidentiellen System zu erkennen ist, erhielten die Bürger ein zusätzliches demokratisches Instrument und hätten mehr Klarheit, über was sie mit welcher Wahl entscheiden. Die Regierungsbildung wäre bei entsprechender verfassungsrechtlicher Ausgestaltung kein Problem mehr. Nicht mehr parlamentarisch legitimierte geschäftsführende Regierungen würden der Vergangenheit angehören.
Andererseits ergeben sich schon bei vorläufiger Betrachtung so viele Risiken und Unwägbarkeiten, dass sich die oben skizzierten Schwierigkeiten schon als dauerhaft unlösbar erweisen müssten, um einen solchen Systemwechsel ernstlich in Betracht zu ziehen. Schaffen die Bürger jedoch auch bei den nächsten Landtagswahlen keine eindeutigen Verhältnisse oder überdenken die Abgeordneten oder Fraktionen ihre parteipolitischen Selbstbindungen nicht, wäre es freilich an der Zeit, den von Bodo Ramelow gesetzten Impuls aufzugreifen und die Vor- und Nachteile gründlich zu wägen. Eine Enquetekommission des Thüringer Landtags könnte dafür der richtige Ort sein.
(Der Verfasser gibt seinen persönlichen Standpunkt wieder.)









